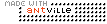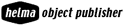webradio
webradio (deutsch)
(deutsch) michael moore
michael moore  Mondlandungs Lüge
Mondlandungs Lüge (deutsch)
(deutsch)

 Tages-Anzeiger online
Tages-Anzeiger online

|
marcosolo, 29. November 2003 um 01:42:06 MEZ
USA - Senioren in Handschellen Von Marc Pitzke, New York Die US-Bundespolizei FBI nimmt Kriegsgegner und Bush-Kritiker als potenzielle Terroristen ins Visier. Selbst harmlose Protestler laufen nun Gefahr, auf die FBI-Abschussliste zu geraten. Bill Neel liebt sein Land. Der 66-jährige Amerikaner hat sein ganzes Leben in Pittsburgh verbracht, hat sechs Jahre lang in der Army gedient und danach 35 Jahre in einer Fabrik für AK Steel geschuftet, einen der größten Stahlkonzerne der USA. "Ich weiß", sagt Neel, "was es heißt, ein Patriot zu sein." Was es jedoch in Zeiten von Krieg und Terror heißt, ein Patriot zu sein, ahnt Neel erst seit vorigem Herbst. Denn "das Recht, meine Regierung zu kritisieren", ist da wohl nicht mehr mit eingeschlossen: Als der Pensionär mit einem Protestplakat zu einem Auftritt von Präsident George W. Bush aufkreuzte, wurde er prompt in Handschellen gelegt. Erst nach Bushs Abreise ließ ihn die Polizei wieder frei und verzichtete auch nur auf Intervention der US-Bürgerrechtsunion ACLU auf eine Anzeige. Neel ist nur einer von inzwischen vielen hundert Fällen in den USA, in denen friedliche Demonstranten über die Beschneidung ihres Verfassungsrechts auf freie Meinungsäußerung klagen. Die Übergriffe, sanktioniert vom drakonischen Anti-Terror-Gesetz "Patriot Act" von 2001, sind längst so zahlreich und weit verbreitet, dass die ACLU darin mittlerweile ein bedrohliches "Muster der Diskriminierung" gegen Andersdenkende zu erkennen beginnt. Opposition in Terror-Nähe gerückt Ein Muster, das sich nun erstmals als eine Strategie der Regierung zu offenbaren scheint, ihre Kritiker mundtot zu machen. Und zwar geht das aus einem internen Memo hervor, das die Bundespolizei FBI im Oktober als "Bulletin Nr. 89" an alle örtlichen Behörden geschickt hat und das diese Woche, gegen den Willen des heimlichtuerischen FBI, bekannt wurde. Darin gibt das Bundesbüro Instruktionen für den Umgang mit regierungskritischen Protestlern. Die örtlichen Polizeistellen, so die zweiseitige Anweisung, mögen fortan "alle potenziell illegalen Akte" bei Anti-Bush-Demos an eine der 66 lokalen Terror-Arbeitsgruppen des FBI melden - also auch das ordnungswidrige Herumtragen von Plakaten außerhalb der polizeilich abgeriegelten "Potestzonen", dessen sich der Rentner Neel schuldig gemacht hatte. Neels Plakat trug die wütende, doch harmlose Aufschrift: "Die Familie Bush lieben die Armen sicher - sie hat so viele von uns arm gemacht." Das Memo zeigt, wie tief die Abneigung der US-Regierung gegen Protest und Widerspruch ist und wie schnell jegliche Opposition seit dem Horror des 11. September 2001 in die Nähe von Terroristen gerückt zu werden droht. Es ist aber auch deshalb bemerkenswert, weil es die ersten offiziellen Hinweise darauf enthält, dass polizeiliche Informationen über die Bush-Kritiker an zentraler Stelle gespeichert werden. Dementi via Leserbrief Das weckt böse Erinnerungen. "Die Linie zwischen Terrorismus und zivilem Ungehorsam wird verwischt", sagt ACLU-Direktor Anthony Romero. "Dies ist ein Rückfall in die Zeiten J. Edgar Hoovers." Unter dem berüchtigten FBI-Chef der sechziger und siebziger Jahre war das Bespitzeln von Bürgerrechtlern, Kriegsgegnern und anderen Unliebigen an der Tagesordnung. Schwere Vorwürfe, die das FBI mit schwerem Geschütz zurückweist. In einem seltenen "Leserbrief" an die "New York Times", die zuerst aus dem Memo zitierte, bestätigte die geheimniskrämerische Behörde zwar dessen Existenz, dementierte aber vehement, dass sie politisch "auf Anti-Kriegs-Demonstranten abzielt". Die "New York Times" verzichtete bisher auf einen Abdruck des FBI-Briefes. Das Original-Memo kann jedoch, bei näherer Ansicht, die Befürchtungen der Bürgerrechtler kaum zerstreuen. Nicht zuletzt die Wortwahl enthüllt, dass Washington zwischen Bush-kritischen "Aktivisten" und mordenden "Terroristen" nur wenig Unterschied macht. Das auf 15. Oktober datierte Dokument - aus einer Reihe allwöchentlicher "Intelligence Bulletins", die die FBI-Zentrale seit 2001 an die Polizei der Bundesstaaten und Städte ausgibt - befasst sich mit den massiven Anti-Kriegs-Demos, die zehn Tage später in Washington und San Francisco geplant waren. Betreff: "Taktiken bei Protesten und Demonstrationen." Sonnenbrillen als Terror-Werkzeuge Gemeint sind die Taktiken der Bush-Gegner. "Die meisten Proteste sind friedliche Veranstaltungen", schreibt das FBI zunächst artig - nur um ein paar Sätze weiter gleich nachzulegen: "Selbst die friedlicheren Techniken können ein Klima der Unordnung schaffen." Genauer gesagt: "Eine Zahl von Demonstrationen" würden "wahrscheinlich gewaltsam und störend" verlaufen. Als Beispiele für die besagten "potenziell kriminellen", sprich terrorverdächtigen Aktivitäten der Bush-Kritiker nennt das FBI das Internet, Fundraising und "Vorab-Koordination von Demonstrationen" - ausnahmslos legale Handlungen, die ebenso gut den Präsidentschaftswahlkampf beschreiben könnten. Ferner im Terror-Visier des FBI: Handys, Walkie-Talkies, Sonnenbrillen (zum Schutz gegen Tränengas), Mülltonnendeckel (zum Schutz gegen Prügel) und Videokameras (zur "Einschüchterung" von Polizisten). Wahllos bezeichnet das Memo die Kriegsgegner ohne Unterscheidung mal als "Aktivisten", mal als "Extremisten"; am Ende landen sie alle in einem Topf. Die von ACLU-Direktor Romero beschworene "Linie zwischen Terrorismus und zivilem Ungehorsam" existiert da nicht mehr. Zum Schluss steht die scharfe Erinnerung, dass dieses Memo "nicht außerhalb von Polizeikreisen zirkuliert werden" dürfte - und insbesondere nicht "gegenüber der Presse". 71-Jähriger im Fadenkreuz Das Memo bestätigt einen Trend, den Bürgerrechtler schon länger beobachten. In Denver gestand das Police Department kürzlich, Jahre lang Informationen über friedliche Aktivisten und Demonstranten gesammelt zu haben - unter dem Archiv-Stichwort "kriminelle Extremisten". Unter den bespitzelten Organisationen: Amnesty International und eine islamische Moschee. Bei der ersten großen Anti-Kriegs-Demo im Februar 2003 setzte die New Yorker Polizei Schlagstöcke und Tränengas ein und galoppierte mit Pferden in die Menge, in der sich auch Kinder und alte Leute drängten. Die Beamten notierten sich die Namen vieler Demonstranten auf Formblättern mit dem Titel "Counter Terrorist Intelligence". Polizeichef Michael Esposito räumte ein, Terror-Verdacht habe im Vordergrund des Einsatzes gestanden. Ähnlich vorige Woche bei den Großprotesten gegen die Freihandels-Konferenz in Miami. Die 8,5 Millionen Dollar, die die Stadt für den Polizeieinsatz ausgab, entstammten dem staatlichen Anti-Terror-Topf - namentlich dem Milliardenpaket des US-Kongresses für den Irak; Miami fand sich da im Kleingedruckten. Die Wirkung dieser Subvention bekam unter anderem auch der 71-jährige Bentley Killmon zu spüren, der mit einer Seniorengruppe zur Demonstration gekommen war. Er wurde von mehreren Polizisten zu Boden gestoßen und mit Handschellen gefesselt. Ein neuer McCarthyismus? Jedes Mal, wenn Bush irgendwo öffentlich auftritt, werden seine jubelnden Fans ganz nahe rangelassen, seine Gegner jedoch in winzigen Freigehegen, mit zynischer Herablassung "Free Speech Zones" genannt, ausgesperrt, oft hunderte Meter entfernt. Wer sich daran nicht hält wie Bill Neel riskiert so nun, auf den zentralen Terror-Listen des FBI zu landen - und verspielt im Ernstfall jeden Anspruch auf den üblichen Verfassungs- und Rechtsschutz, wie die zahllosen in US-Terrorhaft Verschwundenen bezeugen können. Das beunruhigt nicht nur Bürgerrechtler. Senator John Edwards, einer der demokratischen Präsidentschaftsbewerber, hält diese Art der Rasterfahndung für einen neuen "McCarthyismus". Sein Wahlrivale, der Reverend Al Sharpton, geht sogar noch weiter: "Diese Regierung ist gegen jede abweichende Meinung, sie ist gegen Demokratie." Bill Neel bezeichnet sich trotzdem weiter als ein amerikanischer Patriot. "Wenn es nach der Bush-Regierung ginge, würden alle, die sie kritisieren, aus dem Blickfeld verschwinden", sagt er. "Jeder, der sich für einen Patrioten hält, müsste darüber so besorgt sein wie ich." ... Link marcosolo, 25. November 2003 um 20:26:36 MEZ "Die Wahrheit über Bush in 30 Sekunden" Der kommende Präsidentschaftswahlkampf in den USA wirft seine Schatten voraus - und die Opposition hat ihre Stimme wiedergefunden. Publikumswirksam trommeln Top-Stars von Moby über R.E.M.-Sänger Michael Stipe bis Michael Moore für eine rotzfreche Polit-Aktion im Internet. Das Ziel: Bush demaskieren.  REUTERS
Der Druck wächst: Jetzt mobilisiert http://www.moveon.org/ die Straße" gegen Bush
REUTERS
Der Druck wächst: Jetzt mobilisiert http://www.moveon.org/ die Straße" gegen Bush
Man erinnert sich ja kaum mehr daran: Der letzte Präsidentschaftswahlkampf in den USA war nicht zuletzt einer, der im Web geführt wurde. Republikaner und Demokraten beharkten sich mit frechen, oft satirisch gefärbten Websites, und George W. Bush bekam mit Abstand das meiste Fett weg. Vorbei: Die fürchterlichen Terrorattacken vom September 2001 und die folgenden Kriege fegten nicht nur den Humor aus der amerikanischen Politik, sondern ließen lange auch fast jede Opposition verstummen. Doch die regt sich wieder, wird lauter - und entwickelt pfiffige Konzepte, wie dem amtierenden Präsidenten im nächsten Wahlkampf beizukommen wäre. www.moveon.org etwa, ein bereits im letzten Wahlkampf auffälliges Bündnis von Bush-Gegnern, sorgt mit einer Web-Aktion für Furore, die darauf abzielt, "Aufklärungs-Fernsehspots" über George W. Bush zu produzieren. Das Ganze ist ein Ideenwettbewerb, bei dem jeder amerikanische Bürger ab 15 Jahren einen 30 Sekunden langen Spot-Entwurf einreichen kann, der "die Wahrheit über George Bush" vermitteln soll. Bewertet werden die Einreichungen zum einen von einer prominent besetzten Jury, zum anderen von den Web-Nutzern: Die bekommen vom 15. bis zum 31. Dezember Gelegenheit, ihre Stimme für die Filme abzugeben. Dem Gewinner winken Ruhm und eine Videokassette, mehr nicht: Sein oder ihr Spot soll im Rahmenprogramm der Rede des Präsidenten zur Lage der Nation ausgestrahlt werden - ein Affront. Politische Werbespots haben in den USA eine andere Tradition als hier zu Lande. Auch im MoveOn-Ideenwettbewerb geht es nicht darum, einen "Wahlkampfspot" zu produzieren. Das ist dem freien Bündnis sogar ausdrücklich verboten - nicht aber, politisch wirkende Botschaften zu verbreiten. Promis machen Politik "Wir wollen die Aufmerksamkeit auf die verfehlte Politik der Regierung lenken", erklärt der Musiker Moby, einer der Initiatoren der Aktion. In der Jury trifft er auf so prominente wie bekannt oppositionelle Kollegen wie Miachael Stipe von REM, den Filmemacher und Bestsellerautor Michael Moore ("Bowling for Columbine", "Stupid white Men") und Hollywood-Größen wie Michael Mann, Gus Van Sant oder den Pearl-Jam-Sänger Eddie Vedder. Und schnell muss alles gehen: Der Wettbewerb begann am 24. November und läuft bis zum 31. Januar. Für die jährliche Rede des Präsidenten zur Lage der Nation sollen die Spots parat sein - und deren genaues Datum setzt das Weiße Haus an. Die Film-Einreichungen wiederum sollen die Teilnehmer zunächst als maximal vier Megabyte kleine MPG- oder AVI-Entwürfe einsenden - das macht es leicht, sie im Web zu zeigen. Egal also, ob die Ausstrahlung im Umfeld der Präsidentenrede gelingt oder nicht: Im Web entsteht in den nächsten Wochen eine Website mit etlichen "Wahrheiten über Bush in 30 Sekunden", produziert von und für Amerikaner. Aufmerksamkeit ist der Website gewiss - und der frechere Teil des Wahlkampfes hat begonnen, bevor die Demokraten sich auch nur auf einen Gegenkandidaten geeinigt haben. Das Ziel der MoveOn-Aktion kommt ihnen zugute und wurde von Michael Moore in ungezählten Interviews definiert: "Bush loswerden". Frank Patalong very soon on: www.bushin30seconds.org Ein Muster seht ihr unten: ... Link marcosolo, 17. November 2003 um 19:03:04 MEZ Rumsfeld & Saddam Hussein - Der Emissär des Präsidenten Geheime Unterlagen aus den frühen achtziger Jahren erzählen eine bizarre Geschichte: Saddam Hussein und Donald Rumsfeld arbeiteten Hand in Hand. Er gilt als Washingtons Staatsfeind Nummer eins - Saddam Hussein, der geschasste Despot aus dem Zweistromland, den die Supermacht per Steckbrief jagen lässt und lieber tot als lebendig von ihrer Suchliste streichen würde. Doch ausgerechnet einer der ranghöchsten Jäger, Pentagon-Chef Donald Rumsfeld, gehört zu jenen, die einst alles daransetzten, den Baath-Putschisten zu einem Machtfaktor im Nahen Osten aufzubauen. Geheimunterlagen, die nach fast zwei Jahrzehnten erstmals ausgewertet wurden, belegen, wie sehr sich der irakische Diktator damals von Washington und vor allem von Rumsfeld zu einer Hegemonialpolitik ermutigt sehen musste, die schließlich ins mesopotamische Debakel von heute führte. Es ist der Sommer des Jahres 1983, in dem Präsident Ronald Reagan beschließt, die Nahost-Politik der Weltmacht neu zu ordnen. 1979 hatte die Mullah-Revolution den Schah von Persien gestürzt und damit einen der wichtigsten Stützpfeiler Washingtons in der Region beseitigt. Mit der Geiselnahme von US-Botschaftsangehörigen in Teheran waren Chomeini & Co. wenig später zu Erzfeinden des "großen Satans" aufgerückt. In Mekka bedrohte ein Aufstand von Islamisten das saudische Herrscherhaus. Im Libanon lagen Israelis, Syrer und Palästinenser in einem zermürbenden Dauerkonflikt. Und am Hindukusch setzte die Sowjetunion - Reagans "Reich des Bösen" - alles daran, um Afghanistan endlich unter Kontrolle zu bekommen. Da suchte auch im Zweistromland ein Emporkömmling die Gunst der unruhigen Stunde zu nutzen: Saddam Hussein, bereits Vizepräsident, zementierte seine Macht und avancierte zum Staatschef. Ein Jahr später will er dem scheinbar revolutionsgeschwächten Nachbarn Iran reiche Ölfelder entwinden. Doch statt des erhofften Blitzsiegs gerät der Angreifer in die Defensive. Nun glaubt Washington handeln zu müssen, um einen Sieg der verhassten Mullahs zu verhindern. Obwohl die USA öffentlich weiterhin die Friedensresolutionen der Uno nebst internationalem Waffenembargo unterstützen, erhält Bagdad heimlich massive Hilfe: gewaltige Zuschüsse von den Golfstaaten, Staatskredite aus Amerika, Rüstungsgüter über Drittländer und sogar überlebenswichtige Lagebilder amerikanischer Spionagesatelliten. Im Februar 1982 wird der Irak auch noch von der Liste jener Staaten gestrichen, die Washington der Kooperation mit Terroristen beschuldigt. Am 12. Juli 1983 ist so der Boden bereitet, um Washingtons Politik neu zu positionieren. In seiner streng geheimen "National Security Decision Directive 99" (NSDD) unterschreibt Reagan einen Aktionsplan "zur Stärkung der regionalen Stabilität" im Nahen Osten. Zu seinem Sonderbeauftragten beruft er Donald Rumsfeld, seinerzeit Manager eines multinationalen Pharmakonzerns. Die Annäherung an den Irak gilt als eines der wichtigsten Ziele des neuen Kurses. Der amerikanische Geschäftsträger in Bagdad drängt umgehend auf eine Audienz Rumsfelds beim Diktator. Nur dann mache der Besuch des ranghöchsten US-Emissärs seit 1967 überhaupt Sinn. Es gehe darum, einen "direkten Kontakt zwischen einem Vertrauten von Präsident Reagan und Präsident Saddam Hussein" zu etablieren. Begierig ergreifen die Iraker Rumsfelds ausgestreckte Hand. Volle 90 Minuten widmet Saddam Hussein am 20. Dezember 1983 seinem amerikanischen Gast. In einem ellenlangen Geheimtelegramm - von der Londoner US-Botschaft an einen engen Empfängerkreis versandt - zieht die Rumsfeld-Mannschaft tags darauf Bilanz: "Präsident Saddam zeigte sich sichtlich erfreut über den Brief des Präsidenten", den Rumsfeld aus dem Weißen Haus mitgebracht hatte und dessen Übergabe das irakische Fernsehen propagandawirksam aufzeichnete. Auch habe er Reagans "tiefes Verständnis der Konsequenzen des irakisch-iranischen Krieges" gerühmt und seine Anregung zur "Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen" begrüßt. Ausgerechnet bei jenem Despoten, den Washington heute zum Chefterroristen erhoben hat, beklagt sich Rumsfeld: "Die Menschen müssen wissen, dass Terror ein Zuhause hat - in Iran, Syrien und im Libanon." Auch sonst verläuft das Treffen in bester Harmonie. Washington teile Bagdads Sorge vor einem Erstarken seiner Nachbarn Syrien und Iran, umschmeichelt der Amerikaner seinen Gastgeber. Rumsfeld erhebt nicht einmal Einspruch, als Saddam klagt, Amerikas Nahost-Politik habe zeitweilig Gefallen daran gefunden, dass sich "diese Bande von Verrückten gegenseitig die Schädel einschlägt". Stattdessen preist Reagans Sonderbotschafter lieber die "Bereiche großer Gemeinsamkeiten" beider Staaten. Es wäre durchaus "vorteilhaft für den Irak", wenn er "seine natürliche Rolle in der Region ausfüllt, damit die Ambitionen anderer nicht überhand nehmen". Das gefällt dem kriegsgeschundenen Despoten - und wird womöglich als Ermunterung zu anderen Abenteuern begriffen, etwa dem Einverleiben von Kuweit sieben Jahre später. Einer verdeckten Beistandsverpflichtung kommt die Beteuerung gleich, "ein Kriegsausgang, der die Rolle des Irak schwäche, liegt nicht im westlichen Interesse". Voller Verständnis erklärt Reagans Emissär laut diplomatischer Depesche, "unabhängige und souveräne Nationen haben das Recht, Dinge zu tun, mit denen wir oder andere nicht einverstanden sind". Solche "Dinge" sind längst in vollem Gange: Seit Monaten häufen sich Berichte über Iraks völkerrechtswidrigen Einsatz von chemischen Kampfstoffen gegen Iran. Schon im Sommer 1983 hatte Teheran darüber Klage geführt, im Oktober dann im Sicherheitsrat der Uno formell eine Verurteilung des Irak beantragt. US-Geheimdienste bestätigen ihrer Regierung den "nahezu täglichen" Einsatz von Senfgas sowie - eine Novität in der Kriegsführung - des tödlichen Nervengases Tabun. Zehntausende Iraner fallen den Angriffen zum Opfer. Im November erwähnt ein CIA-Report erstmals den Einsatz von Giftgas gegen "kurdische Eindringlinge", mithin gegen Aufständische der eigenen Bevölkerung. Erst als Saddam 1988 in Halabdscha 5000 Kurden mit Giftgas umbringen lässt, erklingt auch in Washington lautstarker Protest. Noch vor der Rumsfeld-Reise warnt das US-Außenministerium, "dass der Irak mit wesentlicher Hilfe durch ausländische Firmen nicht nur in der Lage ist, C-Waffen einzusetzen, sondern vermutlich bereits große Vorräte für den späteren Gebrauch angelegt hat". Doch statt eines geharnischten Protests wegen der Verletzung der Genfer Konvention beschließt Washington, sich "auf die Beobachtung des irakischen C-Waffen-Einsatzes zu beschränken". Reagans Order 114 zum Iran-Irak-Krieg vom 26. November erwähnt den C-Waffen-Einsatz nicht einmal. Auch Donald Rumsfeld unterlässt in Bagdad jeden Hinweis auf die Völkerrechtsverletzungen seines Gesprächspartners. Bei seinem zweieinhalbstündigen Treffen mit Saddam-Vize Tarik Asis versteigt sich der frühere Verteidigungsminister von Präsident Gerald Ford zu einem Monolog über die Vorzüge von Maschinengewehren beim Niedermetzeln von Teherans Revolutionswächtern, die immer wieder in gewaltigen Wogen über irakische Stellungen hereinbrechen. Den C-Waffen-Einsatz erwähnt der Amerikaner nur ganz verklausuliert als einen jener Umstände, die einer intensiveren US-irakischen Kooperation noch entgegenstünden. So reagiert Bagdad "völlig im Schock", berichtet der US-Geschäftsträger am Hofe Saddams, als Washington am 5. März 1984 den Irak doch noch öffentlich rügt. Da aber die US-Regierung zugleich verhindert, dass der Irak im Sicherheitsrat verurteilt wird, sieht sich Saddam in dem Glauben bestärkt, sein Draht zu Reagan über dessen Vertrauten Rumsfeld bleibe die verständnisvolle Basis der bilateralen Beziehungen. Dass Washington sogar bereit war, Handlanger zu sein für den Diktator, hatte Rumsfeld eigens herausgestrichen. "Die Vereinigten Staaten bestärken Dritte, keine Waffen an Iran zu liefern." Stolz versichert er dem dankbaren Diktator: "Wir glauben, dass wir dabei Erfolg hatten." SIEGESMUND VON ILSEMANN ... Link |
online for 8553 Days
last updated: 15.12.12, 03:58  Youre not logged in ... Login

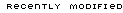 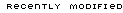 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

View My Guestbook
Sign My Guestbook




marcosolo's 
|
marcosolo  webradio statistics webradio statistics |
Nord- Motorrad-trips in Nord Thailand Motorrad-trips in Nord Thailand
|